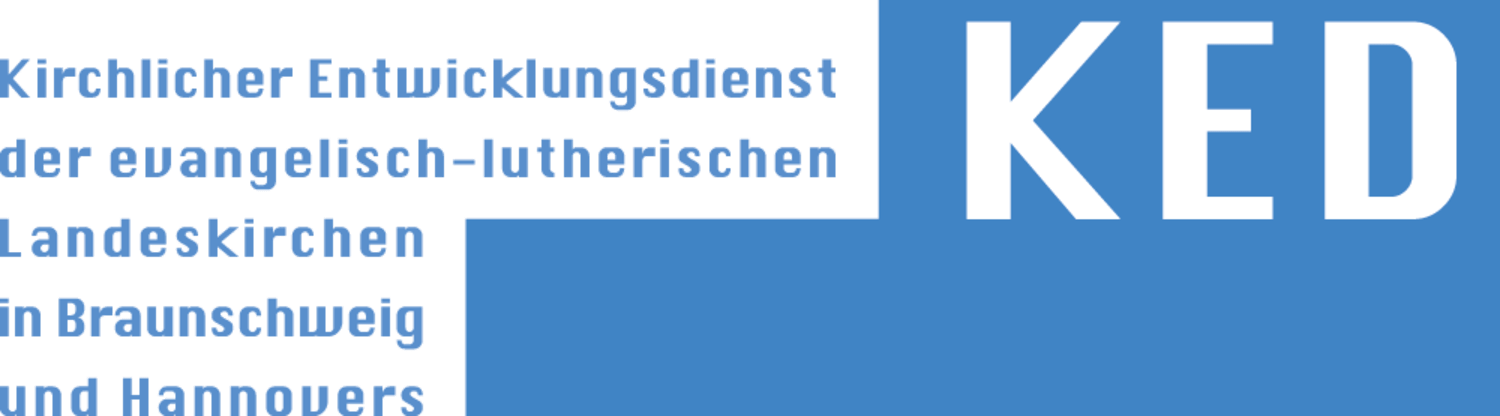Am 16.12. fand in den Räumlichkeiten der Serviceagentur der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers vormittags ein Workshop zum Thema „Vom ökologischen Fuß- und Handabdruck. Erfahre mehr über deine persönliche Umweltbilanz und Möglichkeiten des Engagements für mehr Nachhaltigkeit“ statt. Neben der KED-Praktikantin Lilit Poghosyan und KED-Referentin Maureen von Dassel, waren insgesamt acht internationale Studierende vor Ort.
Nach einer kurzen Begrüßungsrunde wurde abgefragt, inwieweit das Konzept des ökologischen Fußabdrucks bekannt ist und was man darunter versteht. Da für manche Studierende der Fußabdruck “neu“ war, wurde der ökologische Fußabdruck eingangs näher erläutert und als ein Messinstrument für Nachhaltigkeit vorgestellt. Er beschreibt u.a. wie viel Fläche (z.B. Weide- und Ackerland, Fischgründe) eine Person benötigt, um ihren Bedarf an Ressourcen zu decken.
Um eine Idee davon zu bekommen, wie groß der eigene ökologische Fußabdruck ist, konnten die Studierenden als nächsten Schritt den „Fußabdruck Parcours“ als Tischversion ausprobieren. Beim anschließenden Austausch wurde über mehrere Bereiche intensiver gesprochen. So war Mobilität zum Beispiel ein wichtiges Thema, da u.a. die Flugreise ins Heimatland für eine hohe Punktzahl sorgte.
Als positive Ergänzung zum Fußabdruck wurde danach der Handabdruck präsentiert. Der Handabdruck stellt das (pro)aktive Handeln in den Vordergrund. Anders als beim Fußabdruck, bei dem die persönliche Umweltbilanz im Vordergrund steht, geht es beim Handabdruck um Aktionen und Projekte, die auch andere Personen positiv beeinflussen sowie Strukturen und Rahmenbedingungen für mehr Nachhaltigkeit schaffen. Um einen besseren Einblick in das Konzept des Handabdrucks zu bekommen, machten die Studierenden den digitalen Handabdruck-Test von Brot für die Welt und Germanwatch.
Danach fanden sich die Studierenden in 2er- und 3er-Gruppen zusammen und sprachen über das bisherige persönliche Engagement und Bereiche, in denen man zukünftig aktiv werden möchte. Anschließend sollten die Studierenden eine eigene Handabdruck-Idee schriftlich ausformulieren und sich dabei an bestimmten Vorgaben wie Aktionsform, Handlungsebene, Verbündete und Thema orientieren. Bei der anschließenden Vorstellungsrunde, stellten die Studierenden verschiedene Handabdruck-Ideen wie die Installation von Solaranlagen an der Hochschule oder die Begrünung eines Innenhofs (als Teil des Bürogebäudes), z.B. durch den Anbau von Gemüse- und Pflanzenbeeten, vor.
Es war eine insgesamt interessante Veranstaltung, die nicht nur zeigte, wie man den eigenen Fußabdruck minimiert, sondern auch Ideen und Strategien aufzeigte, um selbst für und mit anderen aktiv zu werden.
Maureen von Dassel
Am Abend des 8. Dezember 2024 lud die Evangelische Studierendengemeinde (ESG), unter Leitung von Pastorin Dr. Ina Schaede, gemeinsam mit dem Kirchlichen Entwicklungsdienst der ev.-luth. Landeskirchen in Braunschweig und Hannovers (KED) mit Referentin Rebecca Neumann, zum gemeinsamen Vesperabend in die Kreuzkirche am Kreuzkirchhof in Hannover ein. Ab 18 Uhr gesellten sich zum Vorbereitungsteam insgesamt 10 Besucher*innen, um sich zum Thema „Konnektivität – Was ist gutes Leben?“ auszutauschen (Foto 1).
In ihrer Begrüßung beschrieb Ina Schaede den zweiten Advent als „eine Zeit des Erwartens und der Verbundenheit“ (Foto 2). Mögliche Formen von Verbundenheit (oder Konnektivität) sollten an diesem Abend etwas näher beleuchtet werden und auch welchen Einfluss Konnektivität auf unsere Lebensqualität haben kann.
„Der Begriff „Konnektivität“ könne neben der Vernetzung durch unsere schnell wachsende digitale Welt auch als Verbindung unterschiedlicher Netzwerke verstanden werden“ erklärte Schaede, woraus sich neue Möglichkeiten für unser Alltagsleben ergeben können. Bespiele hierzu lieferte an diesem Abend ein Gastbeitrag von Pastor und Forscher Prof. Dr. Marco Hofheinz von der Leibnitz-Universität Hannover (Institut für Theologie), der bei diesem besonderen Veranstaltungsformat in der Kreuzkirche zum Thema „Freundschaft und Konnektivität“ referierte (Fotos 2 und 3). In seinem Thesen-Impuls beleuchtetet Prof. Dr. Hofheinz wie Freundschaft als der tragende Grund verstanden werden könne, auf dem andere Formen von Konnektivität möglich sind. Eine hochvernetzte Welt ist Teil unserer Lebensrealität und über bestehende Netzwerkstrukturen lassen sich auch soziale Verbindungen pflegen, erklärte Hofheinz zum Einstieg. Das Internet sei aber nicht die Heimat des guten Lebens und des sozialen Austausches, was Hofheinz mit moralisch fraglichen Beispielen der Internetnutzung untermauerte.
„Es brauche Gegenwelten, wie z.B. die Freundschaft, die in unsere (digitale) Realität hineinragen.“ Hofheinz erläuterte u.a. anhand von Aristoteles, warum Freundschaft und der persönliche Austausch unter Freunden für ein gutes Leben stünden. „Sie stehen für die Begegnung mit Menschlichkeit und Menschlichkeit drückt sich in der Freundlichkeit der Freundschaft aus.“
Freundschaft kann als eine Art Horizont verstanden werden kann, der die digitale Konnektivität in einen größeren Zusammenhang stellt, um diese entweder besser zu verstehen oder auch kritisch zu betrachten und weiter zu entwickeln.
Einen weiteren Kontext schaffte Hofheinz mit einem theologischen Bezug auf das Reich Gottes als „Reich der Freundschaft“. Jesus benannte u.a. alle Menschen beim gemeinsamen Mahl als „Freunde“. Was bedeutet das für uns Menschen heute? Und wie sieht es mit der Verbindung zwischen Gott und den Menschen aus? Hofheinz endete hierzu mit den Worten „Jesus ist das Sakrament der Freundschaft zwischen Gott und den Menschen.“
Mit etwas Bewegung zwischendurch wurden die Besucher*innen eingeladen, sich an zwei Themen-Stationen miteinander austauschen:
Die Station „Freundschaft im Bibelkontext“ ermöglichte es den Besucher*innen anhand von Bibelzitaten ihre eigenen persönlichen Bezüge herauszufinden und in der Gruppe zu teilen.
Die Station „Globale Vernetzung“ stellte u.a. den Fairen Handel und ausgewählte Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 vor, mit denen weltweit menschenwürdiges Leben ermöglicht werden soll. Neben menschenwürdigen Arbeitsbedingungen (Ziel 8) sollen auch langfristige Partnerschaften, z.B. im Welthandel zu mehr Chancengleichheit führen. Hierzu wurde auch das Orangen-Projekt „Süß statt Bitter“ vorgestellt, dass sich für faire Arbeitsbedingungen und faire Entlohnung in der Landwirtschaft einsetzt. Über den Fairen Handel durch den Konsum von fair und nachhaltig hergestellten Produkten (Ziel 12) ein „gutes Leben“ für Menschen hier und weltweit ermöglicht werden. Als Beispiel diente eine Auswahl an Fairtrade Schoko-Riegeln, die an diesem Abend verkostet werden konnten und zum Verweilen einluden.
Musikalisch begleitet wurde der Abend u.a. durch die Studierenden Akari Kusube und Nils Schäfer von der Musikhochschule Hannover, die mit klassischen Stücken für eine schöne Atmosphäre in der Kreuzkirche sorgten.
Zum Ausklang des Abends lernte man sich bei Snacks und Getränken etwas mehr kennen und teilte u.a. auch die eigene Perspektive zum Thema Konnektivität und Freundschaft in kleiner Runde.
Das Veranstaltungsformat eignete sich gut, um sich inhaltlich, aber auch über persönliche Sichtweisen zu einem Thema auszutauschen. Des Weiteren konnten ganz gezielt thematische Impulse zu anknüpfenden Themen, wie z.B. dem Fairen Handel, gesetzt und die Bildungsarbeit des KED vorgestellt werden.
Am 4. Dezember 2024 fand im HCC Congress Centrum, das von der Landeskirche organisierte Schülerforum unter dem Motto „Du hast Zukunft“, statt.
Mehr als 1.600 Schülerinnen und Schüler sowie zahlreiche Lehrkräfte hatten die Möglichkeit an Workshops und spannenden Diskussionen teilzunehmen und sich an vielen Ständen zu informieren. Die Workshops behandelten Themen wie „Was trägt dich in die Zukunft?“, „Miteinander im Fokus: Soziale Fahrungsstärken“, „Rückkehr zur Realität“, und „Klima: Krise, Anpassung, Hoffnung?“.
Auch der KED war vertreten. Neben der KED-Praktikantin Lilit Poghosyan, waren die KED-Mitarbeitenden Maureen von Dassel und Patrick Zieger mit einem Infostand vor Ort. Die Schüler und Schülerinnen als auch Lehrkräfte zeigten großes Interesse an dem mitgebrachten Fußabdruck-Parcours (die Fußabdruck-Fragen decken vier Hauptbereiche ab, darunter Energie, Ernährung, Mobilität und Konsum). Durch die Beantwortung der Fragen und der daraus resultierenden Punktzahl hatte man die Möglichkeit zu verstehen, inwieweit der persönliche Lebensstil nachhaltig für die Umwelt ist. Die Teilnehmenden hatten beim KED-Infostand auch die Möglichkeit, sich über das Konzept des Handabdrucks zu informieren. Der Handabdruck stellt das (pro)aktive Handeln in den Vordergrund. Anders als beim Fußabdruck, bei dem die persönliche Umweltbilanz im Vordergrund steht, geht es beim Handabdruck um Aktionen und Projekte, die auch andere Personen positiv beeinflussen sowie Strukturen und Rahmenbedingungen für mehr Nachhaltigkeit schaffen. Im Laufe des vor- und nachmittags entstanden viele interessante Gespräche über mehr Nachhaltigkeit auf persönlicher Ebene sowie Handlungsmöglichkeiten, beispielsweise im Schulalltag.
Lilit Poghosyan
Die Weltgruppe Stade lud am 14. November 2024 zu diesem informativen Abend ins Kulturforum nach Buxtehude ein und zeigte zum Einstieg die 30-minütige Dokumentation „Bittere Orangen“ von Regisseurin Elke Sasse. Dieser Film zeigt das ganze Ausmaß der Ausbeutung auf süditalienischen Plantagen und lässt betroffene Bauern, Erntehelfer und die Engagierten der Initiative „SOS Rosarno“ zu Wort kommen.
Im Anschluss an den Film kamen die rund 40 Besucher:innen mit dem Ethnologen Prof. Dr. Gilles Reckinger ins Gespräch, der als Referent zu diesem Abend eingeladen war.
Herr Reckinger ist Autor des Buches „Bittere Orangen“. Seine Forschungsschwerpunkte sind u. a. die europäischen Prekarisierungs-Prozesse und die Migration. Er erforscht die Lebens- und Arbeitsbedingungen der migrantischen Erntearbeiter in Europa und eben auch in Rosarno, der Region, aus der unsere ökologisch angebauten und fairen Früchte stammen, die die Weltgruppe Stade seit 2022 verkauft.
Herr Reckinger ließ die Zuhörer:innen teilhaben an seiner über 10-jährigen Forschungsarbeit in den prekären Brennpunkten der europäischen Landwirtschaft, an der Entwicklung hin zu den aktuellen Zuständen, den erbärmlichen Zeltstätten, am Tagelöhnerdasein ohne jegliche Absicherung und den Rassismuserfahrungen der Erntehelfer.
Er machte aber auch deutlich, mit welcher Zuversicht die Migranten trotz allem diese Zustände ertragen und wie solidarisch sie diese Lebenssituation meistern – mit der Hoffnung auf ein lebenswerteres Leben, vor allem für ihre Familien in der Heimat.
Die Anstrengungen der in Kalabrien aktiven Initiativen wie SOS Rosarno zeigen, dass eine Orangen-Produktion ohne Ausbeutung von Kleinbauern und Erntehelfern möglich ist. Das ist ein kleiner Lichtschein – aber es ist ein Lichtschein! Die Einhaltung des europäischen Arbeitsrechtes mit den für uns selbstverständlichen Absicherungen ist auch gegenüber den migrantischen Erntehelfern möglich. Die Gesetze sind da, sie müssen nur eingehalten und kontrolliert werden. Die europäische Politik schaut über diese Zustände hinweg – trotz der Rechtslage.
Aber jede und jeder Einzelne kann die Augen offenhalten und sein eigenes Konsumverhalten mit kleinen Schritten fair und nachhaltig gestalten.
Um diesen Abend abzurunden, waren auch Aktive von „Unites4Rescue“, „Buxtehude im Wandel“, vom Loseladen „Tante Trude“ und vom Weltladen Buxtehude vor Ort, um über ihre Arbeit und Projekte zu informieren. Man kam ins Gespräch und es wurde intensiv genetzwerkt.
Diese Veranstaltung verlief in Kooperation mit dem Kirchlichen Entwicklungsdienst (KED) Niedersachsen begleitet durch KED-Referentin Rebecca Neumann, Ansprechpartnerin für die Vernetzungs- und Bildungsarbeit für Orangen-Akteure in Niedersachsen.
Bericht von Susanne Decker-Michalek und Marina Vollmann, Weltgruppe Stade
Beim KED-Infoabend am 26. September war Herbert Irahola, der Leiter der Bildungsabteilung der „Fundación Jubileo“ in La Paz, zu Gast in Hannover. „Zwischen Goldrausch und Staatsbankrott – Boliviens schwieriger Weg aus dem Extraktivismus“ lautete das Thema, zu dem der KED in ökumenischer Kooperation mit dem Bistum Hildesheim eingeladen hatte. Dr. Dietmar Müßig, der Referent für Bolivienpartnerschaft und Ökotheologie im Bistum Hildesheim, begleitete den Gast bei dessen Deutschlandbesuch und fungierte auch als Dolmetscher zwischen ihm und den rund 20 Besuchern dieses Vortrags- und Diskussionsabends beim KED.
Bolivien befindet sich in diesem Jahr in dreifacher Hinsicht in einer Krisensituation, wie Irahola erläuterte. Er unterschied dabei eine ökologische, eine politische und eine wirtschaftliche Dimension:
Eine langanhaltende extreme Dürre hat dazu geführt, dass Brandrodungen im Regenwald der Amazonas-Region völlig außer Kontrolle geraten sind. Größer als die Schweiz ist die Gesamtfläche der verbrannten Wald- und Weidegebiete, deren überwiegend indigene Bevölkerung nicht nur materielle Verluste, sondern auch gesundheitliche Schäden erlitten hat und teilweise in Städte umgesiedelt werden musste.
Konflikte innerhalb der politischen und militärischen Führung des Landes mündeten im Juni in einen gescheiterten Putschversuch. Im September steigerten sich Proteste gegen die Regierung zu großen Demonstrationen mit gewaltsamen Zusammenstößen.
Das ökonomische Modell des Extraktivismus, d.h. die einseitige Ausrichtung der Wirtschaft auf den Export von Rohstoffen wie Erdgas, Lithium und Gold, hat Natur und Menschen geschädigt, ohne dem Staat noch ausreichende Einnahmen zur Finanzierung notwendiger Ausgaben einzubringen. Dadurch ist die Verschuldung des Staates in den letzten Jahren auf ein kritisches Niveau gestiegen.
Die zunehmende Last der Staatsschulden stellt, wie Irahola betonte, eine wesentliche Hürde für die Bewältigung der großen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen Boliviens dar. In der „Fundación Jubileo“ engagiert er sich daher gemeinsam mit internationalen Partnern wie dem deutschen Bündnis „erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung“ für faire und transparente Verfahren zur nachhaltigen Lösung von Staatsschuldenkrisen weltweit. Die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und das Bistum Hildesheim sind die beiden größten Mitträger von „erlassjahr.de“ innerhalb Niedersachsens.
Andreas Kurschat
Am 20. September 2024 lud die Stadt Garbsen alle Bürgerinnen und Bürger zur dritten Umweltmesse „GREEN UP!“ in die Rathaushalle nach Garbsen Mitte ein. Die Stadt ist seit 1993 dem Klima-Bündnis beigetreten und setzt Maßnahmen um, die dem Klimaschutz und der Verringerung von Umweltbelastungen dienen.
Bei der Umweltmesse stellten Institutionen, Unternehmen und Vereine ihre Arbeit zu aktuellen Umweltthemen an Info-Ständen vor, wie z.B. nachhaltige Energielösungen, Gebäudesanierungen und umweltfreundliche Mobilität (Foto 1a,b und 2).
Schulklassen aus verschiedenen Garbsener Schulen machten an diesem Tag einen großen Anteil der Besuchergruppen aus. Der Bürgermeister Claudio Provenzano, der die Veranstaltung eröffnete (Foto 2), dankte u.a. allen teilnehmenden Gruppen der Müllsammelaktion, die diese Messe wieder begleitete. Teilgenommen hatten insgesamt sieben Schulen, aber auch Kitas und Privatpersonen konnten ihren gesammelten Müll am Rathausplatz abgeben. Über 200 Säcke an Müll kamen bei dieser Sammelaktion zusammen. Unter den Teilnehmenden wurde ein kleines Preisgeld ausgelost, welches u.a. die Schülerinnen und Schüler der IGS Garbsen für ihr großes Engagement erhielten.
Auch zu Umweltschutz und ökologischer Nachhaltigkeit hier und weltweit gab es auf der Umweltmesse viel zu erfahren: Die Diskussionsrunde „Klimaschutz macht Ah!“, angeboten vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu), lud die Messebesucher*innen ein, rund um das Thema „Klimaschutz auf den Teller – Wie kann unsere Ernährung das Klima schützen?“ mit zu diskutieren.
Am Stand der Stadt Garbsen wurden die städtischen Klimaschutzprojekte vorgestellt (Foto 2 links neben der Bühne). Darunter wären u.a. Pflanzprojekte mit klimaresistenteren Baumarten oder Blühstreifen-Patenschaften auf landwirtschaftlichen Flächen zu nennen. Eine Umweltrallye, entwickelt vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, führt in der Stadt zu sieben interaktiven Stationen, mit interaktiven Fragen und Fakten zu Klima- und Umweltschutz. Ein Müllmonster (Foto 4a vorne links) diente am Stand als weiterer Blickfang, welches in (Grund-)Schulen zum Thema Mülltrennung und Müllvermeidung, unter Leitung von der Umweltbeauftragten Randi Diestel und der Klimaschutzmanagerin Maike Barsties von der Stadt Garbsen, zum Einsatz kommt.
Der Wasserverband Garbsen-Neustadt informierte darüber, was die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserversorgung einer Region haben kann. Die Zuverlässigkeit und Qualität einer Wasserversorgung hängt hauptsächlich von den vorhandenen Wasserressourcen vor Ort ab. Ändern sich Klimabedingungen, kann dies zu Veränderungen von Niederschlagsmengen führen. Dies zusammen mit der vermehrten Versiegelung von Bodenoberflächen verringert die Neubildung von Grundwasser, aus dem über die Hälfte unseres Trinkwassers besteht. Wasserversorgungsunternehmen müssen also in Zeiten hoher Wasserentnahme, z.B. trockenen Sommern, genügend Wasser vorhalten, damit die Anlagen und Leitungssysteme nicht überlastet werden. Der Erhalt von Wasserschutzgebieten ist ein Weg, wie Wasserversorger nachhaltig Grundwasser für eine Region schützen können.
Informationen zur Fairtrade-Stadt Garbsen hielt Regionaldiakonin Andrea Spremberg der ev.- luth. Kirchenregion Garbsen Süd und Marienwerder stellvertretend für die Steuerungsgruppe der Stadt bereit (Foto 4 a,b). Garbsen ist seit März 2014 als Fairtrade Stadt ausgezeichnet worden. Besucher*innen konnten am Stand den fair gehandelten Städtekaffee „Faire Bohne Garbsen“ verkosten, der seit 2014 in den Garbsener Geschäften angeboten wird. Dieser Kaffee wird nach streng ökologischen Kriterien in den bolivianischen Anden angebaut. Eine Bolivien-Partnerschaft seitens der Katholischen Kirche stellt den direkten Kontakt in die Herstellerregion und war mit ausschlaggebend für die Entstehung des Städtekaffees. Am Info-Stand kam man über die Vorteile der Verwendung von Kaffee aus dem Fairen Handel ins Gespräch. Durch faire Handelbeziehungen können Kleinbauern und Arbeiter in den Anbauländern in eine nachhaltige Zukunft investieren.
In Kooperation mit dem KED und Referentin Rebecca Neumann (Foto 4 b) wurden Standbesucher*innen auch über den Beitrag des Fairen Handels zum Umwelt- und Klimaschutz informiert und es wurde erklärt, wie Handelsgerechtigkeit zu mehr Klimagerechtigkeit beitragen kann.
Mit Blick auf die Wintersaison lud Regionaldiakonin Spremberg zudem Interessierte ein, sich mit dem Kauf von bio-solidarischen Orangen aus Süditalien am „Süß statt Bitter“ Projekt zu beteiligen. Allein durch eine faire Bezahlung der Kleinproduzenten für ihre Produkte können feste Arbeitsverträge für ihre Erntehelfer geschlossen werden. Ein Vorzeige-Projekt, wie im Bereich Landwirtschaft mehr Fairness erreicht werden kann. Bestellmöglichkeiten und Bildungsmaterialien zu den Orangen wurden vorgestellt und ein Legespiel informierte über die Preiszusammensetzung von einer Kiste Bio-Orangen (á 10 kg), die man zwischen Dezember und April direkt von den Erzeugern in Süditalien bestellen kann.
Insgesamt bot die Messe nicht nur Informationen, sondern auch eine Plattform für den Austausch zwischen Bürgern, Unternehmen und lokalen Initiativen. Die Bewerbung des Orangen-Projektes stieß u.a. bei Lehrkräften auf großes Interesse, als ein Aktionsformat, was sich nicht nur in Kirchengemeinden, sondern auch in Schulen gut umsetzen lassen kann.
Rebecca Neumann
Bei bestem Wetter luden am 29. August 2024 die Mitarbeitenden der Stiftung der Peter und Paul-Kirche Elze und des Cafés zur Marktzeit an ihrem Info- und Verkaufsstand zum Verweilen ein. Der Veranstaltungsort des Feierabendmarktes war dieses Mal der Rolandplatz aufgrund von Baumaßnahmen auf dem sonst genutzten Kirchplatz. Die Stiftung der Kirchengemeinde verkaufte an ihrem Stand diverse gerahmte Fotos der Kirche und umliegender Denkmäler und lud zu Sekt und fair gehandeltem Orangensaft ein. Alle Einnahmen fließen in die Stiftungsarbeit. Am Stand des Café Teams nebenan konnten die Marktbesucher unter anderem zum Thema Klima und Fairer Handel mit KED-Referentin Rebecca Neumann ins Gespräch kommen. Das Team des Cafés zur Marktzeit bot auch wieder ein ausgewähltes Angebot an Produkten aus dem Fairen Handel zum Verkauf an, worunter auch klimaneutraler Kaffee von El Puente zu finden war. Nicht vermeidbare CO2-Ausstöße während der Kaffeeproduktion werden über die Klima-Kollekte (www.klimakollekte.de) kompensiert, wodurch im Globalen Süden u.a. erneuerbare Energien ausgebaut oder durch Projekte der Energie-Effizienz die Lebensgrundlagen vor Ort verbessert werden können.
Ein Klima-Quiz ermöglichte den Standbesuchern einen Einblick in die CO2-Bilanzen bei der Herstellung diverser Lebensmittel wie Butter, Milch, Rindfleisch, Orangensaft oder Kaffee, worunter (für manche überraschend) Butter mit der schlechtesten CO2-Bilanz einzuordnen war.
Trotz angekündigtem Unwetter, anfänglichen Windböen und dann großer Hitze, wurde das bunte Programm des letzten Feierabendmarktes in diesem Jahr insgesamt gut besucht und Menschen von jung bis alt haben sich am Stand der Kirchengemeinde informiert und einige persönliche Aspekte ihrer Lebensweise mit uns geteilt. Vielen Dank dafür!
Rebecca Neumann
Am 4. August 2024 feierte die Peter-und-Paul-Kirchengemeinde in Elze einen besonderen Sommergottesdienst: Es wurde die offizielle Verabschiedung von Brigitte Dittmann aus ihrem langjährigen leitenden Ehrenamt im „Café zur Marktzeit“ und als Leitung des „Fairen Frühstücks“ gefeiert.
Wie schön es ist, sich für andere einzusetzen und mit den eigenen Stärken und Gaben einzubringen, war das einleitende Thema der Verabschiedungsfeier. Eingebettet in den Gottesdienst, geleitet durch Pastor Jens-Arne Edelmann, ging dieser mit den Besucherinnen und Besuchern der Frage auf den Grund: „Was leitet mich in meinem Leben, woran orientiere ich mich?“ Der Chor „Melodies4you“ stimmte auch musikalisch mit dem Titel „Lead me, guide me“ zum Thema ein. Pastor Edelmann lud mit der Bibelstelle Markus 12, 28–34 dazu ein zu überlegen, worauf es im Kern eigentlich ankommt, damit wir ein gutes Leben mit unseren Mitmenschen führen können. Dabei verwies er auf die Liebe Gottes als höchstes Gebot, dass uns leitet, nicht nur uns selbst lieben zu lernen, sondern auch auf andere offen zugehen zu können.
Frau Dittmann leitete 20 Jahre lang das „Café zur Marktzeit“ als verantwortungsvolle und engagierte Nachfolgerin der Initiatoren Kerstine und Albrecht Westphal, die das Café am 6. Mai 1996 gründeten. Im Jahr 2001 übernahm sie zudem federführend die Leitung des „Fairen Frühstücks“, das einmal jährlich im Rahmen der „Fairen Woche“ zum gemeinsamen Essen und Austausch einlädt. Zusammen mit ihren Teams organisierte Frau Dittmann zahlreiche Veranstaltungen wie Vorträge, Konzerte oder Lesungen und hatte stets Menschen vor Ort und auch weltweit bei ihrer gemeinnützigen Arbeit im Blick, die sie u.a. mit den Spendenerlösen des „Fairen Frühstücks“ unterstützte.
Ganz besondere Dankesworte erhielt Frau Dittmann noch von Menschen und Gruppen, die sie auf ihrem Weg begleiten durften. Zum Start überreichten die Eheleute Westphal eine „Gute-Wünsche-Kiste“, die u.a. neben Gute-Laune-Schokolade und Glückstee auch einen symbolischen Geduldsfaden und den „Nuevo Futuro“-Kaffee enthielt, mit dem Wunsch, sich zukünftig auch wieder mehr Zeit für sich zu nehmen. Im Anschluss kamen KED-Referentin Rebecca Neumann und KED-Praktikantin Lilit Poghosyan nach vorne und überreichten Frau Dittmann nach einem kleinen Dankeswort einen goldfarbenen Ehrenpokal als symbolische Anerkennung für ihre tolle Arbeit in den Gemeindegruppen und die Förderung vieler sozialer Projekte hier und weltweit.
Mit der Überreichung dieses Ehrenpokals an Brigitte Dittmann drückt der KED symbolisch seine Anerkennung aus. Michelle Langer und Johanna Kurt vom Diakonischen Werk in Elze dankten für die regelmäßigen Spendenmittel, die Frau Dittmann mit ihrer Arbeit generieren konnte. Und die gesamten Teams des „Cafés zur Marktzeit“ sowie des „Fairen Frühstücks“ drückten ihren gebührenden Dank für die verlässliche Leitung und motivierende Arbeit von Frau Dittmann aus. Große „Dankeschön-Runde“: Rita Rekatzky (links vorne am Pult) lobt mit den Teams des „Cafés zur Marktzeit“ und des „Fairen Frühstücks“ das Engagement von Brigitte Dittmann (Mitte) als federführende Leitung. Rechts von der Mitte sind neben Pastor Edelmann weitere Mitfeiernde versammelt, darunter Michelle Langer und Johanna Kurt vom Diakonischen Werk in Elze, die Eheleute Albrecht und Kerstine Westphal und KED-Referentin Rebecca Neumann. Die Entpflichtung durch Pastor Edelmann am Ende des Gottesdienstes nahm auch eine große Last von Frau Dittmanns Schultern und sie freute sich, wie sie sagte, schon auf ihre zukünftigen Besuche bei Aktivitäten in der Kirchengemeinde als „ganz normales Gemeindemitglied“.
Rebecca Neumann
In Kooperation mit Julia Harmeling vom Hochschulbüro für Internationales (HI) der Leibniz Universität Hannover (LUH) bot KED-Referentin Maureen von Dassel mit der Unterstützung von KED-Praktikantin Lilit Poghosyan am 24. Juni einen fairen und nachhaltigen Spaziergang im Stadtteil Linden an.
Man startete den Spaziergang am Treffpunkt Apollokino mit insgesamt 7 Teilnehmenden. Bei strahlendem Sonnenschein ging es Richtung erster Station: Allerweltsladen Hannover. Rita Otte, eine Mitarbeiterin des Ladens, begrüßte uns herzlich und gab eine kurze Einführung zum Thema Fairer Handel und zur Bedeutung von Weltläden innerhalb des Fair-Handels-Systems. Bei der Vorstellung des eigenen Ladens hörte man nicht nur die Begeisterung für die Geschichten hinter den Produkten heraus, sondern wurde sich auch der Rolle ehrenamtlichen Engagements bewusst, ohne das der Allerweltsladen sowie (fast) alle Weltläden in Deutschland nicht existieren könnten. Was es alles an unterschiedlichen Produkten im Laden zu entdecken gibt, wurde deutlich, als die internationalen Studierenden die Aufgabe bekamen, Produkte aus ihren Heimatländern zu suchen. Aus dem Jemen, Nicaragua, Ägypten, Armenien und Marokko kommend, suchten die Studierenden zwischen den Regalen und man wurde u.a. beim Spielzeug, Kaffee und bei den Schokoladentafeln fündig.
Am Wasser entlang ging es danach weiter zum Imker Helmut Reusch, der nahe der Leine eine kleine grüne Oase namens „Die Schwärmerei“ hat. Während um uns herum seine Bienen summten, sprach Helmut über die Bedeutung der Honig- und Wildbienen für uns Menschen. Ohne sie gebe es zum Beispiel diese große Auswahl an Obst, Gemüse und Blumen nicht. Dass Bienenschutz wichtig ist und wie man als Einzelperson hier unterstützen kann, wurde mit den Studierenden thematisiert. Den Unterschied zwischen ökologischer und konventioneller Bienenhaltung erklärte uns Helmut u.a. anhand von dem (Nicht-)Eingreifen in die Bienenvolkentwicklung. Anfassen, anschauen und probieren war ausdrücklich erlaubt und so konnten wir zum Beispiel einen Blick auf die Waben werfen und verschiedene Honigsorten verkosten.
Nach unserem Besuch bei Helmut spazierten wir weiter zur dritten und letzten Station unseres Ausflugs, dem Ladencafé Mulembe in Hannover-Limmer. Hier wurden wir von der Mitarbeiterin Clara Günther in Empfang genommen. Bei einem leckeren Cappuccino, Latte Macchiato oder wahlweise auch Eiscafé saßen wir im Café und Clara erzählte uns mehr über die Geschichte des Kaffees. Die Kaffeebohnen werden von Kaffeebäuerinnen- und bauern aus Uganda direkt bezogen. Neben einer hohen Kaffeequalität ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Produzierenden vor Ort das Hauptanliegen von Anna Lina Bartl, der Gründerin von "Mulembe Kaffee.“ Clara erzählte, dass man u.a. die Kaffeebäuerinnen und -bauern vor Ort bei der Kaffeeproduktion unterstützt, faire und verlässliche Höchstpreise zahlt sowie gemeinsam neue Anbauprodukte wie Kakao, Vanille, Zimt und Honig als weitere Einkommensquelle ausmacht und die Umsetzung aktiv begleitet. Eine Kooperation mit dem zuvor besuchten Imker Helmut besteht auch. So gibt er als Bienenexperte Informationen über den Bau von Bienenstöcken an die Kaffeebäuerinnen und -bauern in Uganda weiter. Alles in allem war es ein interessanter, sonniger Nachmittag, der uns und den Studierenden zeigte, wie faire und nachhaltige Projekte in diesem Stadtteil umgesetzt werden können.
Maureen von Dassel
Unter dem Motto „Was die Zukunft bringt“ fand in Verden vom 30.05.–02.06.2024 das diesjährige Landesjugendcamp der Evangelischen Jugend statt. Auch der KED reiste für den Freitag (31.05.) an, mit im Gepäck war der Ökologische Fußabdruck sowie interessantes Info- und Anschauungsmaterial, u.a. zum Fairen Handel. Das Wetter spielte leider nicht ganz so mit, doch trotz der teilüberfluteten Camp-Wiese und einer geringeren Teilnehmendenzahl als erwartet war die Stimmung am Stand gut und die Motivation, mitzumachen und ins Gespräch zu kommen, da.
Während die KED-Referenten Andreas Kurschat und Maureen von Dassel den Ökologischen Fußabdruck anleiteten und über die Arbeit des KED informierten, bot KED-Praktikantin Lilit Poghosyan im Rahmen des Camps einen interaktiven Workshop zum Thema „Frieden ist durch Friedensmechanismen möglich!“ für Jugendliche an. Ziel des Workshops war es, jungen Menschen eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre zum Teil sehr persönlichen Vorstellungen zum Thema Frieden ausdrücken und mit anderen diskutieren konnten.
Nach dem Austausch sehr interessanter Gedanken zum Thema Frieden und der Begründung von unterschiedlichen Ansichten und Meinungen befasste sich der Workshop mit Textzitaten, u.a. aus der Bibel sowie von berühmten Persönlichkeiten wie Martin Luther, Papst Johannes Paul II. und Abraham Lincoln. Hier ging es darum, verschiedene Ansichten von Frieden sowie Hindernisse für eine Aufrechterhaltung von Frieden kennenzulernen und in Kleingruppen zu diskutieren. Nach einer aktiven Diskussionsrunde kamen die Teilnehmenden zu dem Schluss, dass sowohl die Bibel als auch Personen des öffentlichen Lebens, z.B. aus der Politik, teils sehr ähnliche Komponenten auf dem Weg zum Frieden erwähnen sowie Hindernisse benennen.
Im zweiten Teil des Workshops referierte Lilit Poghosyan über Mechanismen zur Friedensbildung. Durch ihr Masterstudium („Conflict Studies and Peacebuilding“) vertraut mit dem Thema, bot sie einen politiktheoretischen Einblick und stellte u.a. die von der internationalen Gemeinschaft umgesetzten Mechanismen zur Versöhnung von Konflikt- oder Kriegsparteien, einschließlich Verhandlungen, Vermittlung usw., vor. Es wurde auch kurz auf konkrete Beispiele wie den israelisch-palästinensischen und den israelisch-ägyptischen Konflikt verwiesen, bei denen Mediation als Mechanismus zur Konfliktlösung eingesetzt wurde. Insgesamt war es ein sehr aktiver Workshop, der durch die angeregten Diskussionen und Kleingruppenarbeit gut bei den Teilnehmenden ankam.
Lilit Poghosyan und Maureen von Dassel
Mit diesem Appell lud Pastorin Carola Beuermann die Mitglieder der Kirchenkreissynode (KKS) in Celle am 29. Mai 2024 ins Urbanus-Rhegius-Haus ein (Foto 1). Als Umweltbeauftragte des Kirchenkreises und Leiterin des 6-köpfigen Umweltausschusses der KKS beleuchtete Frau Beuermann in einer kurzen Ansprache das Schwerpunktthema dieser KKS, die ganz unter dem Motto „Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ stand.
Zum Einstieg verglich sie die verschiedenen Übersetzungen des folgenden Satzes aus der Schöpfungsgeschichte „Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“ (1. Mose 1,28) Sie erklärte, dass das Leitbild für das tägliche Handeln für den Kirchenkreis Celle keineswegs die Ausbeutung der Natur sein solle, sondern dass sich Umweltschutz und nachhaltiges Handeln heute zunehmend im Bewusstsein der Menschen verankert hätten und eine aktive Beteiligung in den Kirchengemeinden möglich sei.
Ziel der Veranstaltung war es, den anwesenden Vertretern der Kirchengemeinden beispielhaft einen Einblick in die Umsetzung einer öko-fairen Beschaffung zu ermöglichen und lokale Projekte vorzustellen, die leicht auf Kirchengemeindeebene umzusetzen sind. Hierzu konnten sich die Synodenmitglieder an verschiedenen Info-Ständen zu folgenden Nachhaltigkeitsthemen informieren und austauschen:
Das Programm „Grüner Hahn“ stellte der Umweltmanagementbeauftragte Bernd Rakowski aus der Kirchengemeinde Klein Hehlen vor (Foto 2). Zur „Umsetzung von Bio-Diversitätsprojekten auf Friedhöfen“ informierten Helga Schuller und Joachim Gries aus der Johanniskirchengemeinde Eschede. Jens-Uwe Donath vom Imkerverein Celle und Ralf Müller (Foto 3), Klimamanager im Kirchenkreis Celle, gaben ebenfalls Einblicke in ihre Arbeit. Zur Beteiligung an einer öko-fairen Beschaffung, „z.B. beim Fair-Handels-Partner El Puente“, lud Superintendentin Andrea Burgk-Lempart ein.
Nachhaltiges Papier und Servietten sowie fair gehandelter Kaffee werden im Kirchenkreis Celle bereits seit 2019 über Bündeleinkauf für teilnehmende Kirchengemeinden bereitgestellt. Weitere Gemeinden wurden eingeladen mitzumachen. Auch Oblaten oder Wein und Saft für einen fairen Altar können öko-fair beschafft werden.
„Niederschwellig anzufangen und dabei Spaß zu haben“, gab Frau Beuermann den Synodenmitgliedern noch mit auf den Weg. „Wer einmal anfängt, der hört auch nicht wieder auf“, sprach Sie aus eigener Erfahrung.
KED-Referentin Rebecca Neumann und KED-Praktikantin Lilit Poghosyan stellten zudem an einem Info-Stand beispielhaft verschiedene Projekte und Ideen vor, mit denen der KED Kirchenkreise und Kirchengemeinden bei der Bildungsarbeit zu verschieden Themen der öko-fairen Beschaffung unterstützt (Foto 4). Gerade die Bildungsarbeit im Rahmen der Jugendarbeit hat großes Potenzial, und Bildungsmaterialien, z.B. für die Konfirmandenarbeit, waren von großem Interesse bei den Standbesuchern.
Neben der Bildungsarbeit ist auch die persönliche Beratung von Kirchengemeinden und kirchlichen Gruppen zur Umsetzung von nachhaltigen Beschaffungsprojekten ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit. Das Vorleben einer nachhaltigen Lebensweise kann für alle Gemeindeglieder wertvoll und inspirierend sein. Bei Interesse sprechen Sie KED-Referentin Rebecca Neumann (neumann@ked-niedersachsen.de) gern persönlich für weitere Informationen an.
Rebecca Neumann
Am Abend des 28. Mai 2024 luden die Leitenden des Predigerseminars alle Vikare der Landeskirche Hannovers auf eine Rundfahrt mit dem Solarboot auf dem Maschsee ein (Foto 1). Neben dem Austausch untereinander diente die Veranstaltung dazu, dass sich 13 von insgesamt 18 Vikaren mit verschiedenen Vertretern aus Einrichtungen der Landeskirche Hannovers austauschen konnten.
Kurze inhaltliche Beiträge lieferte zunächst Denise Irmscher von Brot für die Welt. Sie stellte die Arbeit ihrer Organisation in Form eines Bingo-Spiels vor. KED-Referentin Rebecca Neumann stellte dann in einem kurzen Dialog mit Praktikantin Lilit Poghosyan ihren Arbeitsbereich beim KED vor und lud dazu ein, die Themen der öko-fairen Beschaffung in die Arbeit in den Kirchengemeinden ganz praktisch mit einfließen zu lassen. Als kleine Anregung hierfür diente u.a. das Bildungsmaterial zu Kakao und Schokolade sowie ein schokoladiges Geschenk mit öko-fairen Zutaten für alle Vikare (Fotos 2–4). Vom Haus kirchlicher Dienste stellte abschließend Pastor Daniel Rudolphi sein Arbeitsfeld Religiosität und Weltanschauungen vor und lud zum Austausch ein.
Zum Ausklang des Abends konnten sich alle Teilnehmenden am veganen Büffet an Bord stärken und bei bestem Wetter die Natur und den Sonnenuntergang auf sich wirken lassen.
Rebecca Neumann
Am 16. Mai lud die Stadt Elze bereits zum achten Mal zum Feierabend-Markt ein, beim dem sich nicht nur die üblichen Wochenmarktstände, sondern auch Vereine, politische Gruppen und Einzelpersonen aus Elze und Umgebung vorstellen. Auch die Peter-und-Paul-Kirchengemeinde beteiligte sich von 17 bis 20 Uhr mit einem Info- und Aktionsstand und bot fair gehandelte Produkte aus ihrem Café zur Marktzeit an. KED-Referent Andreas Kurschat und KED-Praktikantin Lilit Poghosyan informierten in Zusammenarbeit mit Rita Rekatzky, Brigitte Dittmann und anderen vom Team der Kirchengemeinde über den Fairen Handel und dessen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.
Ungünstige Wetterbedingungen hinderten interessierte Passanten zum Glück nicht, einen Moment stehen zu bleiben und sich über den Fairen Handel mit uns auszutauschen. Auch ein Quiz lud dazu ein, weiterführende Informationen über die Prinzipien des Fairen Handels zu erhalten und fair gehandelte Schokolade zu probieren.
Darüber hinaus wurde auf die Kampagne „Mit Schulden fair verfahren!“ vom entwicklungspolitischen Bündnis erlassjahr.de hingewiesen, das sich für faire Schuldenerlasse in kritisch verschuldeten Staaten einsetzt. Denn ohne umfassende Schuldenerlasse sind die UN-Nachhaltigkeitsziele wie das Beenden von Hunger und Armut sowie Gesundheit und Bildung für alle nur schwer zu erreichen. Die Kampagne, die man mit dem Unterschreiben von Postkarten an die Bundesregierung unterstützen konnte, kam sehr gut bei den Passanten an. Die Postkarten wurden gesammelt und am 18. Juni beim Aktionstag für faire Entschuldung in Köln als Teil einer längeren Kette zusammengetragen.
Lilit Poghosyan
Wie man sich eine nachhaltige Produktion von Röstkaffee und einen fairen Direkthandel mit Kaffeebohnen konkret vorstellen kann, erfuhren entwicklungspolitisch interessierte junge Leute am 20. April in den Betriebsräumen von „Mulembe Kaffee“ in Hannover-Limmer. Anna Lina Bartl, die Gründerin dieser Direkthandelsfirma mit eigener Rösterei und Ladencafé, empfing dort in ihrem Seminarraum eine international zusammengesetzte Studentengruppe von STUBE Niedersachsen mit zwei Kannen frisch zubereitetem Kaffee unterschiedlicher Sorte.
Ein Geschmacksvergleich führte unmittelbar in die spannende und vielschichtige Welt der Kaffeeproduktion hinein. Beide Sorten stammten aus Uganda aus dem nachhaltigen Anbau der kleinbäuerlichen Geschäftspartner von „Mulembe Kaffee“, doch waren die Bohnen nach der Ernte unterschiedlich aufbereitet worden: die einen trocken, die anderen nass.
Ausführlich und anschaulich schilderte die Agrarwissenschaftlerin, die durch Feldforschung in Uganda zur Gründung ihrer eigenen Kaffeefirma angeregt worden war, welche Stadien die Produktionskette von der Kaffeepflanze bis zum frisch gebrühten Kaffee umfasst, wie sie mit wissenschaftlicher Expertise sowohl die Kaffeequalität als auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen ihrer Geschäftspartner in Uganda zu optimieren versucht und mit welchen Herausforderungen sie dabei bisher z.B. durch die COVID-Pandemie, den Klimawandel, soziale Gegebenheiten im Anbaugebiet oder die Veränderung politischer Rahmenbedingungen konfrontiert gewesen ist.
So erläuterte sie u.a., wie sie die mit ihr zusammenarbeitenden Kleinbauern bei der Diversifikation der Anbauprodukte unterstützt, sodass sie neben Kaffee auch Kakao, Vanille und Zimt anpflanzen, um der Abhängigkeit von einem einzigen Produkt zu entgehen. Zur Illustration zeigte sie nicht nur aus der Rinde des Zimtbaums gewonnenes Gewürzpulver, sondern auch einige Zimtblätter, die gerade bei ihr eingetroffen waren.
Für allgemeines Erstaunen sorgte dabei die Frage eines Studenten, ob er eines dieser Blätter essen dürfe. In seiner Heimat sei das üblich und gelte als gesund für die Zähne. Selbstverständlich durfte er, und andere probierten nun ebenfalls davon. Ob der einhellige Zuspruch bewirkt, dass es künftig auch Zimtblätter im Sortiment von „Mulembe Kaffee“ geben wird, bleibt abzuwarten.
Andreas Kurschat
Am 16. April haben sich auf Einladung von Natalie Gerlach und Vanessa Halbig (Fair in Braunschweig e.V.) sowie Maureen von Dassel (Kirchlicher Entwicklungsdienst) sieben Weltläden im Haus der Kulturen in Braunschweig eingefunden. Man kam zusammen, um sich gemeinsam über das Thema Bildungsarbeit inner- und außerhalb des eigenen Weltladens auszutauschen und “Neues“, sei es in Form von Bildungsmaterialien oder Kooperationsmöglichkeiten, kennenzulernen.
Nach ein paar Aufwärm-Übungen und einem Kennenlernspiel waren Körper und Geist wach und man startete das inhaltliche Programm mit guten Beispielen aus der eigenen Bildungsarbeit. Die Fair-Handels-Aktiven, u.a. aus Peine, Braunschweig, Göttingen und Hildesheim, präsentierten neben Unterrichtseinheiten zu den Themen Faire Fußbälle und Kakao anlassbezogene Veranstaltungsformate wie „Gespräche im Weltladen“ zum 50. Jubiläum oder gaben einen Einblick in verschiedene Narrative, um Kunden und Kundinnen über den Fairen Handel im Laden zu informieren. Anschließend kam man beim World Café ins Gespräch und tauschte sich u.a. über Themen der Bildungsarbeit, Zielgruppen und Kooperationspartner- und partnerinnen aus.
Mit einem kurzen Impuls von Maureen von Dassel zum Thema der Fairen Woche „Fair! Und kein Grad mehr. Junge Stimmen für mehr Klimagerechtigkeit“ wurde sowohl ein möglicher Anlass als auch eine Zielgruppe für diesjährige Bildungsformate präsentiert. Hierbei wurde auf Studien eingegangen, in denen das Interesse junger Menschen an Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen ermittelt und abgefragt wurde, welche Rolle Bildungsarbeit dabei einnimmt. Zum Abschluss gab es einen Markt der Möglichkeiten, bei dem an drei Stationen verschiedene Bildungsmaterialien, u.a. vom KED und dem Verein Fair in Braunschweig, wie der Ökologische Fußabdruck, das Weltverteilungsspiel und ein SDG-Glücksrad ausprobiert werden konnten.
Insgesamt war es ein sehr konstruktiver und informativer Tag, bei dem sich erneut zeigte, wie wichtig der Austausch der Weltläden untereinander ist und welch unglaubliche Expertise und Motivation die Fair-Handels-Aktiven mitbringen.
Grund genug, um diesen Schwung mitzunehmen und eine weitere (Online-)Veranstaltung für und mit Weltläden diesen Herbst anzubieten.
Maureen von Dassel
Vom 12. bis 14. April 2024 fand in Springe ein STUBE-Seminar mit dem Titel „Frieden ist möglich! – Perspektiven für Frieden und Konfliktlösung weltweit“ statt. Neben STUBE Niedersachsen war auch das Freiwilligenprogramm des Evangelisch-lutherischen Missionswerks in Niedersachsen (ELM) an der Organisation dieses Seminars beteiligt. Gefördert wurde das Seminar durch den Fonds „Frieden stiften“ der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.
Die Wahl des Themas war kein Zufall und berücksichtigte die aktuelle Spannungslage in den internationalen Beziehungen. Neben anderen Konflikten ist die internationale Gemeinschaft mit mindestens zwei großen Kriegen konfrontiert, darunter dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem israelisch-palästinensischen Krieg im Gaza-Streifen.
Zu Beginn hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sowohl in Gruppen als auch in gemeinsamen Diskussionen ihre Meinungen und Gedanken zum Thema Frieden zu äußern. Die Teilnehmer versuchten, den Begriff „Frieden“ zu analysieren und zu erklären, was Frieden aus ihrer Sicht ist und wie Frieden geschaffen werden kann. Alle Diskussionen wurden von interaktiven Spielen begleitet, um viele Informationen zu erhalten und gleichzeitig Spaß zu haben.
Im ersten Hauptteil des Seminars wurde eine Exkursion zum Antikriegshaus in Sievershausen organisiert und die Teilnehmer erhielten viele Informationen über das Haus. Sie besichtigten auch die St.-Martins-Kirche, die vor vielen Jahrhunderten erbaut wurde und deren Turm dazu diente, Menschen vor kriegerischen Angriffen zu schützen. Die Nachbarschaft des Antikriegshauses war voller Pflanzen und Bäume mit einer jahrhundertealten Geschichte.
Beispielsweise steht dort neben einem Deserteur-Denkmal ein Kirschbaum, der an eine interessante historische Begebenheit erinnert: „Die Kirschen der Freiheit“ ist der Titel eines Buches von Alfred Andersch über seine eigene Desertion im Jahr 1944. Darin erzählt er, dass er auf der Flucht von der Wehrmacht einen wilden Kirschbaum fand. Er genoss die Kirschen und stellte sich vor, dass die Zeit ihm gehöre, solange er sie aß. Er nannte sie „Deserteurs-Kirschen“ oder „Kirschen der Freiheit“. An diese Geschichte erinnert der Baum beim Antikriegshaus.
Unter den Bäumen ist auch der Korbiniansapfel zu erwähnen, der ebenfalls in der Nähe des Antikriegshauses steht. Dieser Baum stammt vom Original-Baum ab, den der bayerische Pfarrer Korbinian Aigner während seiner Zeit im Konzentrationslager gezüchtet hat. Außerdem gab es im Antikriegshaus interaktive Übungen, Diskussionen und Gruppenarbeiten, die sich mit der aktuellen Situation in Ländern, die derzeit mit Konflikten und Kriegen konfrontiert sind, und mit lokalen Friedensförderungsprojekten zur Lösung dieser Konflikte befassten.
Im zweiten Hauptteil des Seminars wurden Vorträge zum israelisch-palästinensischen Konflikt und zum russisch-ukrainischen Krieg gehalten, die von den Teilnehmern vorab vorbereitet wurden. Die Vorträge zum israelisch-palästinensischen Konflikt konzentrierten sich auf die historischen Wurzeln der Konflikte, die damalige Verschärfung der Situation und die Konfliktlösungsmechanismen (v.a. Mediation), die in den letzten Jahrzehnten mit internationaler Beteiligung zur Beilegung der Konflikte eingesetzt wurden. Im Anschluss an den Vortrag folgte eine sehr intensive und informative Diskussion und es wurden mehrere Argumente zu den Unterschieden zwischen dem israelisch-palästinensischen Konflikt und dem russischen Angriffskrieg erörtert.
Lilit Poghosyan
Am 4. April startete das Nachhaltigkeitsbüro der Landeshauptstadt Hannover die Kampagne „Unsere Kita handelt fair!“ mit der Auszeichnung des inklusiven Kinderladens „Villa Kunterbunt e.V.“ als erste „FaireKITA“ Hannovers. Wenngleich ich als KED-Referentin hier privat und weniger beruflich involviert war, so möchte ich in dieser KED-Ausgabe gerne darüber berichten, da die Kampagne ein toller Anreiz für Kindertagesstätten, Kindergärten und Elterninitiativen ist, sich mit Fairem Handel zu beschäftigen und dieses Thema langfristig sowohl in der pädagogischen Arbeit als auch in der Beschaffung zu verankern.
Als Mutter zweier Kinder in der Villa Kunterbunt habe ich den Weg von der Entscheidung „Ja, wir bewerben uns!“ bis hin zur Urkundenvergabe Anfang April als Mitglied des Faire-Kita-Teams aktiv begleitet und kann sagen, dass es für die Kinder, das pädagogische Team und auch die Eltern sehr bereichernd war. Spielte das Thema eines fairen und gerechten Umgangs im Kinderladen schon immer eine wichtige Rolle, so weiß man jetzt mehr über die teils unfairen Arbeits- und Lebensbedingungen vieler Produzentinnen und Produzenten im Globalen Süden. Dass meine Tochter jetzt nur noch Orangensaft mit dem Fairtrade-Siegel kaufen mag, sei dazugesagt.
Insgesamt gibt es fünf Kriterien, die erfüllt werden müssen, um den Titel „FaireKITA“ zu bekommen. So muss ein Beschluss gefasst und ein Faires Team (bestehend aus z.B. einem Mitarbeitenden der Einrichtung sowie einer Vertretung der Eltern) gebildet werden. Die Verwendung von mindestens zwei fairen Produkten wie Kaffee, Orangensaft oder Honig wird, wie auch die Öffentlichkeitsarbeit, ebenso vorausgesetzt.
Die Bildungsarbeit zum Fairen Handel mit den Kindern ist meines Erachtens das wichtigste Kriterium. Während der vergangenen Monate haben sich die 18 Kinder der Villa Kunterbunt zum Beispiel mit den Themen faire Sportbälle, Kakao aus fairem Anbau und nachhaltigem Spielzeug beschäftigt. Als Unterstützung für das pädagogische Team, das u.a. ein faires Frühstück mit den Kindern durchführte, kam die Bildungsreferentin Agatha Stickdorn-Ngonyani – kurz Ombeni – (vermittelt über das Nachhaltigkeitsbüro) gleich zweimal in die Villa und machte mit den Kindern neben einer einwöchigen Kakaoreise einen Upcycling-Workshop, bei dem die Kinder aus Materialien wie Kronkorken und Holzstäben Autos und Musikinstrumente bastelten. Die Eltern wurden mit anlassbezogenen Aktionen für das Thema Fairer Handel begeistert. So gab es zum Internationalen Frauentag faire Rosen und Infomaterial zum Mitnehmen oder man traf sich nachmittags zur Tasse fair gehandeltem Kaffee auf dem De-Haen-Platz in der List.
Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich sagen, dass die vergangenen Monate etwas ins Rollen gebracht haben und die Auszeichnung eine große Motivation ist, unser bisheriges Engagement zu verstetigen. Der Titel „FaireKITA“ wird für drei Jahre vergeben und danach bezüglich der Einhaltung der Kriterien erneut überprüft und bestenfalls verlängert.
Informationen zur Auszeichnung und zu den Unterstützungsangeboten gibt es auf der "FaireKITA"-Website des Nachhaltigkeitsbüros. Hier findet man auch mehr Informationen über Workshops, die von den Einrichtungen kostenlos gebucht werden können, Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher sowie eine Erstberatung zur Auszeichnung „FaireKITA“.
Maureen von Dassel
Perspektiven auf britischen Kolonialismus und Sklavenhandel lernten internationale Studierende der Fachhochschule für Interkulturelle Theologie (FIT) Hermannsburg kennen, als sie am 10. Februar das Historische Museum Hannover und den KED besuchten. Die aktuelle Sonderausstellung „Von golden Kutschen und kolonialer Vergangenheit“ stand im Mittelpunkt dieser Tagesexkursion, die von Prof. Dr. Moritz Fischer von der FIT und PD Dr. Fritz Heinrich von der Universität Göttingen in Kooperation mit dem KED organisiert wurde. In der Ausstellung gab Ben van Treek, freier Mitarbeiter des Museums, sachkundig darüber Auskunft, welche Rolle die Sklaverei im entstehenden britischen Weltreich während der 123-jährigen hannoverschen Herrschaft in London spielte und in welchen Beziehungen auch die niedersächsischen Untertanen des Königs zur britischen Wirtschafts- und Militärpolitik standen. Dabei ging es u.a. darum, wie im sogenannten Dreieckshandel sowohl Dinge als auch Menschen als Ware über den Atlantik verschifft wurden, was der Philosoph
Gottfried Wilhelm Leibniz in Hannover über Sklaverei schrieb und welche Luxusgüter aus den britischen Kolonien damals in Deutschland besonders gefragt waren. Nach einem Blick auf das rekonstruierte Leibniz-Haus in der Nachbarschaft des Museums schlenderte die Gruppe durch die Altstadt Hannovers zum KED, wo die Studierenden ihre Eindrücke von der Ausstellung austauschen und ihre eigene Sicht auf die Thematik ins Gespräch einbringen konnten. Manche fanden es bemerkenswert, dass ein außerhalb Afrikas gelegenes Museum wie dieses sich überhaupt so kritisch mit unbequemen Aspekten der Geschichte auseinandersetzt.
Die Diskussion beim KED beschränkte sich jedoch nicht auf das Verhältnis zwischen Europa, Afrika und Amerika in jener Zeit. Auch die schon zuvor
betriebene Sklaverei innerhalb afrikanischer Gesellschaften wurde dazu in
Beziehung gesetzt. Nicht zuletzt ging es auch um die theologische Relevanz
des Themas, das sich ja bis in antike Gesellschaften Europas und des Vorderen
Orients zurückverfolgen lässt und an verschiedenen Stellen der Bibel eine Rolle spielt. Am Ende stand die Frage, wie es heute weltweit um menschenwürdige Le-
bens- und Arbeitsbedingungen bestellt ist. Dass in dieser Hinsicht noch erhebliche Defizite zu beklagen sind, wurde dabei ebenso hervorgehoben wie auch, dass beispielsweise der Faire Handel ein unterstützenswerter Ansatz ist, um jedenfalls in bestimmten Segmenten der Wirtschaft deutliche erbesserungen
zu erreichen.
Andreas Kurschat
Im Rahmen der Veranstaltung „Gemeinsam aktiv – mach mit!“ unter Leitung von Monika Schlonski konnten sich am 21. März 2024 Seniorinnen und Senioren in der St. Petri- Kirchengemeinde in Melle zum Thema Fairer Handel austauschen. Ziel der Veranstaltung war es nicht nur, die Vorteile von Fairtrade-Produkten hervorzuheben, sondern auch zu erklären, inwieweit fair gehandelte Produkte von Folgen des Klimawandels betroffen sein können. KED-Praktikantin Lilit Poghosyan unterstützte die Veranstaltung mit einem Vortrag zum Klimawandel und den verheerenden Auswirkungen des Klimawandels auf Rohstoffe wie Kaffee, da die Samen und Blätter der Kaffeepflanze sehr empfindlich und anfällig sind für Dürre, Hagel und unbeständige Wetterbedingungen. Die 15-köpfige Teilnehmergruppe hatte nicht nur Gelegenheit, sich mit ausgewählten Klimaschutz-Maßnahmen von Fairtrade vertraut zu machen, sondern lernte auch Beispiele von Fairtrade-Kaffee kennen, die klimaverträglich produziert wurden und keine zerstörerische Wirkung auf unsere Natur haben. Neben fair gehandeltem Kaffee wurde auch Kuchen aus fairen Zutaten angeboten und beides trug zu einer gelungenen Veranstaltung bei, die am Ende auch im Rahmen einer Diskussionsrunde Gelegenheit für Rückfragen und Austausch bot.
Lilit Poghosyan & Rebecca Neumann
Am 25.01. fand im Café im Haus am Kreuzkirchhof vormittags zum zweiten Mal ein Workshop zum Thema „Perspektivwechsel vom Fuß- zum Handabdruck: Wie kann ich meinen Alltag nachhaltiger gestalten und Veränderungen anstoßen?“ statt. Neben den KED-Referentinnen Luisa Kroll und Maureen von Dassel haben insgesamt fünf internationale Studierende teilgenommen.
Nach einer kurzen Begrüßungsrunde wurden Kenntnisse über das Konzept des ökologischen Fußabdrucks und eventuelle Vorerfahrungen abgefragt. Herauskam, dass der Fußabdruck den meisten Studierenden bekannt ist, besonders mit nachhaltiger Mobilität war man durch das Studium vertraut. Als ein Messinstrument für Nachhaltigkeit beschreibt der ökologische Fußabdruck wie viel Fläche (z.B. Weide- und Ackerland, Fischgründe) eine Person benötigt, um ihren Bedarf an Ressourcen zu decken.
Um eine Idee davon zu bekommen, wie groß der eigene ökologische Fußabdruck ist, konnten die Studierenden als nächsten Schritt das Spiel „Fußabdruck Parcours“ ausprobieren. Beim anschließenden Austausch wurde über mehrere Bereiche intensiver gesprochen. Einer Studentin aus Nigeria fiel z.B. negativ auf, dass Reparaturen von Elektrogeräten in Deutschland relativ teuer sind und das Angebot hier gering ist. Dem konnten die anderen Studierenden nur zustimmen. Auch darüber, dass in Deutschland einige Lebensmittel wie Gurken oder Tomaten oft verpackt sind, wunderte man sich. Aha-Momente gab es auch. Zum Beispiel war den meisten nicht bewusst, dass Streaming-Dienste einen hohen CO2-Verbrauch haben.
Als positive Ergänzung zum Fußabdruck wurde danach der Handabdruck präsentiert. Der Handabdruck stellt das (pro)aktive Handeln in den Vordergrund. Anders als beim Fußabdruck, bei dem die persönliche Umweltbilanz im Vordergrund steht, geht es beim Handabdruck um Aktionen und Projekte, die auch andere Personen positiv beeinflussen sowie Strukturen und Rahmenbedingungen für mehr Nachhaltigkeit schaffen. Um einen besseren Einblick in das Konzept des Handabdrucks zu bekommen, machten die Studierenden den digitalen Handabdruck-Test von Brot für die Welt und Germanwatch. Danach sollten die Studierenden Bereiche identifizieren, in denen sie gerne aktiv(er) werden möchten und anschließend eine Handabdruck-Idee formulieren.
Neben verschiedenen Interessensgebieten und Herangehensweisen, wurde deutlich, dass die Teilnehmenden bereits Engagement zeigen und sich daraus Anknüpfungspunkte für weitere Aktionen ergeben. Ein Student ist z.B. bereits im kamerunischen Verein aktiv und möchte in diesem Umfeld durch (Informations-)Veranstaltungen über umweltbewussteren Konsum, wie den Kauf von regionalen und saisonalen Lebensmitteln, informieren. Einem anderen Studenten ist die Umsetzung erneuerbarer Energie in seinem Heimatdorf wichtig und hier möchte er aktiv werden. Als Hausaufgabe sollten die Studierenden mögliche Schritte für die Umsetzung ihrer Ideen formulieren.
Eine insgesamt interessante Veranstaltung, die nicht nur zeigte, wie man den eigenen Fußabdruck minimiert, sondern auch Ideen und Strategien aufzeigte, um selbst aktiv zu werden.
Maureen von Dassel
Angesichts der Bedeutung der Abfallwirtschaft für eine saubere Umwelt, ihrer wichtigen Rolle bei der Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und des Interesses internationaler Studierender am Prozess der Abfallwirtschaft führte STUBE Niedersachsen am 5. März 2024 eine Exkursion zum Abfallbehandlungszentrum Hannover-Lahe durch. Der Besuch dort wurde organisiert von Andreas Kurschat (KED-Referent für STUBE Niedersachsen) und Maureen von Dassel (KED-Referentin für Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit).
Ziel der Exkursion war es, praktisch zu verstehen, wie eine große Menge Müll entsorgt werden kann, wie verschiedene Abfallarten gesammelt und behandelt werden. Ein Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsgemeinschaft Region Hannover (aha) zeigte den Teilnehmern alle Bereiche, in denen der Abfall sortiert und bearbeitet wird, wobei der Schwerpunkt auf der mechanisch-biologischen Anlage für Restmüll, der Kompostieranlage für Bioabfälle und der Kompostieranlage für Grünabfälle lag. Es entwickelte sich eine lange und aufschlussreiche Diskussion über das Abfallmanagement in Hannover-Lahe.
Als Resultat der Behandlung von Bio- und Grünabfall entsteht Kompost, der als natürlicher Dünger für private Gärten and öffentliche Parks genutzt werden kann. Der Restmüll wird in Grob- und Feinabfälle aufgeteilt. Die Grobabfälle werden zur Stromerzeugung in die benachbarte Müllverbrennungsanlage transportiert, die Feinabfälle werden vergoren, um Methangas für die Strom- und Wärmeerzeugung in einem Blockheizkraftwerk zu gewinnen und so die Menge des Mülls zu reduzieren, der auf eine Deponie gebracht werden muss.
Neben der modernen Abfallbehandlungsanlage gibt es in Hannover-Lahe auch noch eine Deponie. Sie ist eine von drei Deponien der Abfallwirtschaftsgemeinschaft Region Hannover (aha). Ihr ältester Teil wurde 1937 von der Stadt Hannover als Zentraldeponie Altwarmbüchener Moor angelegt und bis 1982 genutzt. Heute gilt sie als bedeutendes Rekultivierungsprojekt. Sie ist mit einer Plane abgedichtet, die vor Erosion schützt und als Barriere gegen eine Beeinträchtigung der Umwelt durch den Müll dient. Die Plane ist mit Humus und Pflanzen bedeckt. Der so entstandene grüne Hügel heißt Nordberg und wird im Volksmund auch Monte Müllo genannt. Obwohl die Höhe des Hügels aufgrund der natürlichen Bodensenkung langsam geringfügig abnimmt und regelmäßig gemessen wird, wirkt der Hügel aufgrund der Rekultivierung wie ein natürlicher Hügel mit einer bestimmten Flora und Fauna.
Lilit Poghosyan