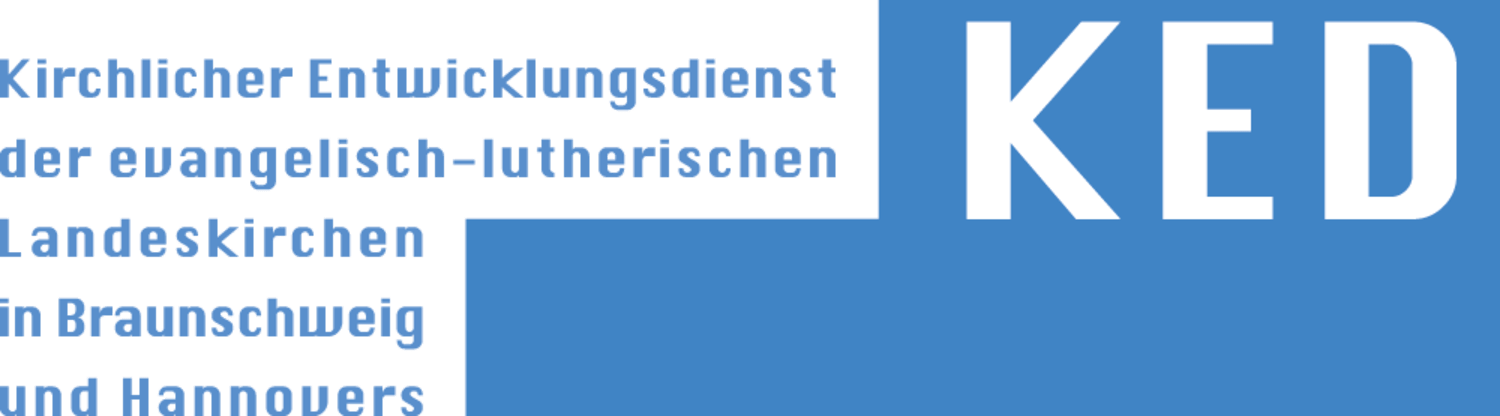Moore in Niedersachsen und Moorregenwälder auf Borneo (Indonesien) bildeten die Themenschwerpunkte beim KED-Infoabend am 6. November 2023 im Rahmen des Programms „November der Wissenschaft“ der Landeshauptstadt Hannover. Über viele Jahre hinweg sind ausgedehnte Moorlandschaften weltweit durch Eingriffe wie Torfabbau, Abholzung und die Umwandlung in Acker-, Plantagen- oder Siedlungsland verloren gegangen – mit negativen Folgen nicht nur für die Artenvielfalt, sondern auch für das Klima. Denn Moore sind natürliche Kohlenstoffspeicher und wirken dadurch äußerst effizient dem Treibhauseffekt entgegen.
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joosten, international bekannter Moorwissenschaftler vom Greifswald Moor Centrum, stellte diesen Zusammenhang in seinem Überblicksvortrag anschaulich dar: Schon eine 15 Zentimeter dicke Torfschicht enthält mehr Kohlenstoff pro Hektar als ein viele Meter hoch gewachsener tropischer Regenwald. Werden Moore jedoch entwässert, so verrottet die organische Substanz und verwandelt sich in Kohlendioxid, das dann den Treibhauseffekt verstärkt. Joosten zufolge gehört Deutschland im weltweiten Vergleich zu den zehn Ländern mit den höchsten Treibhausgasemissionen aus trockengelegten Moorgebieten, von denen viele in Niedersachsen liegen.
Ulrich Sippel, stellvertretender Referatsleiter im Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, stellte das Programm Niedersächsische Moorlandschaften vor, mit dem die Landesregierung eine verstärkte Wiedervernässung von Mooren anstrebt. Er wies darauf hin, dass insbesondere die landwirtschaftliche Nutzung von Moorlandschaften als Acker- oder Intensivgrünland hohe Treibhausgas-Emissionen verursacht. Als einfach zugängliche Informationsquelle zur Situation in Niedersachsen empfahl er das speziell für dieses Bundesland entwickelte Online-Moorinformationssystem MoorIS.
Nina-Maria Gaiser, Projektmanagerin im Bereich Wald- und Biodiversitätsschutz beim Verein BOS – Borneo Orangutan Survival Deutschland in Berlin, berichtete von der praktischen Arbeit der Wiedervernässung im Bereich des Torfmoorregenwaldes Mawas auf der indonesischen Insel Borneo, wo Lebensraum für die vom Aussterben bedrohten Orang-Utans wiederhergestellt wird. Indonesien ist bekannt für seine dramatischen Verluste an intakten Moorlandschaften in den letzten Jahrzehnten. Inzwischen gibt es dort jedoch vermehrt Projekte zur Wiedervernässung, Aufforstung und Feuerprävention. Über das BOS-Projekt in Mawas informiert eine spezielle Internetseite: www.lebenswald.org.
Das Interesse an der Veranstaltung beim KED war groß: Mit über 50 Personen – darunter Studierende ebenso wie Fachleute verschiedener Forschungseinrichtungen, Angehörige von Umweltschutzorganisationen und weitere Interessierte – war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Gelegenheit zur Diskussion mit den drei Gästen auf dem Podium wurde intensiv genutzt.
Andreas Kurschat
Seit mehr als 20 Jahren lädt die Faire Woche jeden September alle Menschen in Deutschland dazu ein, Veranstaltungen zum Fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu organisieren. Mit jährlich rund 2.000 Aktionen ist sie bundesweit die größte Aktionswoche des Fairen Handels.
Auch in der Peter-und-Paul-Gemeinde in Elze sind die ehrenamtlichen Damen vom Café zur Marktzeit in diesem Jahr wieder aktiv. Am 21.09.23 und 28.09.23 haben Sie auf dem Marktplatz vor der Kirche mit ihrem Stand zur Marktzeit erneut ein Zeichen für den Fairen Handel gesetzt. Seit mittlerweile drei Jahren werden an diesem Stand im Freien allerlei faire Produkte verkauft. Mit einem eigenen Stand direkt daneben unterstützte der KED den Verkauf der Gemeinde nun zum dritten Mal
Der Elzer Standverkauf kam hauptsächlich zustande, da während der Corona-Pandemie das Café zur Marktzeit geschlossen bleiben musste. Seit über 25 Jahren können Besuchende bereits im Café zur Marktzeit fairen Kaffee und Tee genießen. Seit mittlerweile zehn Jahren begleitet der KED die Gemeinde in Elze dabei, ihr Engagement in Bezug auf den Fairen Handel auszubauen, und berät und unterstützt sie seitdem dabei. Der Pastor Dr. Jens-Arne Edelmann betont die gute Beziehung und erklärt: „Die Landeskirche unterstützt diese sehr wichtige Arbeit, aber wir brauchen noch ein paar Fachkenntnisse und haben uns deswegen den KED dazu geholt.“
Luisa Kroll
Niedersächsische Perspektiven auf britischen Kolonialismus und Sklavenhandel lernten internationale Studierende der Fachhochschule für Interkulturelle Theologie (FIT) Hermannsburg kennen, als sie am 10. Februar das Historische Museum Hannover und den KED besuchten. Die aktuelle Sonderausstellung „Von golden Kutschen und kolonialer Vergangenheit“ stand im Mittelpunkt dieser Tagesexkursion, die von Prof. Dr. Moritz Fischer von der FIT und PD Dr. Fritz Heinrich von der Universität Göttingen in Kooperation mit dem KED organisiert wurde. In der Ausstellung gab Ben van Treek, freier Mitarbeiter des Museums, sachkundig darüber Auskunft, welche Rolle die Sklaverei im entstehenden britischen Weltreich während der 123-jährigen hannoverschen Herrschaft in London spielte und in welchen Beziehungen auch die niedersächsischen Untertanen des Königs zur britischen Wirtschafts- und Militärpolitik standen. Dabei ging es u.a. darum, wie im sogenannten Dreieckshandel sowohl Dinge als auch Menschen als Ware über den Atlantik verschifft wurden, was der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz in Hannover über Sklaverei schrieb und welche Luxusgüter aus den britischen Kolonien damals in Deutschland besonders gefragt waren. Nach einem Blick auf das rekonstruierte Leibniz-Haus in der Nachbarschaft des Museums schlenderte die Gruppe durch die Altstadt Hannovers zum KED, wo die Studierenden ihre Eindrücke von der Ausstellung austauschen und ihre eigene Sicht auf die Thematik ins Gespräch einbringen konnten. Manche fanden es bemerkenswert, dass ein außerhalb Afrikas gelegenes Museum wie dieses sich überhaupt so kritisch mit unbequemen Aspekten der Geschichte auseinandersetzt.
Die Diskussion beim KED beschränkte sich jedoch nicht auf das Verhältnis zwischen Europa, Afrika und Amerika in jener Zeit. Auch die schon zuvor
betriebene Sklaverei innerhalb afrikanischer Gesellschaften wurde dazu in
Beziehung gesetzt. Nicht zuletzt ging es auch um die theologische Relevanz
des Themas, das sich ja bis in antike Gesellschaften Europas und des Vorderen Orients zurückverfolgen lässt und an verschiedenen Stellen der Bibel eine Rolle spielt. Am Ende stand die Frage, wie es heute weltweit um menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen bestellt ist. Dass in dieser Hinsicht noch erhebliche Defizite zu beklagen sind, wurde dabei ebenso hervorgehoben wie auch, dass beispielsweise der Faire Handel ein unterstützenswerter Ansatz ist, um jedenfalls in bestimmten Segmenten der Wirtschaft deutliche erbesserungen
zu erreichen.
Andreas Kurschat
Bereits zum dritten Mal fand am 16. Februar im Café des Kirchlichen Entwicklungsdienstes (KED) ein faires Krimi-Dinner statt. Die insgesamt neun Gäste – eine Gruppe Lehrender der Berufsbildenden Schule 2 der Region Hannover – konnten dabei nicht nur ein leckereres Drei-Gänge-Menü genießen, sondern wurden in den Rollen fiktiver Charaktere zugleich in einen Mordfall verwickelt, den es aufzuklären galt. Das „Küchen-Team“ des KED – Maureen von Dassel, Andreas Kurschat und Luisa Kroll – hatte das Menü mit Zutaten aus möglichst fairer, ökologischer und saisonaler Produktion zubereitet, passend zur Rahmenhandlung des spannenden Krimidinner-Spiels „Tödliche Enthüllungen: Mord in Schokistedt“, das die Landeshauptstadt Hannover herausgegeben hat. So fand man sich, zumin- dest gedanklich, auf einem Empfang in Schokistedt wieder, bei dem die Auszeichnung der Stadt als Fairtrade-Town gefeiert werden sollte. Das fiktive Mordopfer hatte gerade erst einen Laden für fair gehandelte Waren aus nachhaltiger Produktion eröffnet.
Auch Themen des Fairen Handels wie die Herstellung von Natursteinen ohne Kinderarbeit oder die Glaubwürdigkeit verschiedener Siegel und Zertifikate flossen ins Spiel mit ein und wurden den Teilnehmenden auf spielerische Art und Weise nähergebracht. Die Aufgabe, den Mordfall zu lösen, wurde von allen gerne angenommen. Während der gemeinsamen drei Stunden verdächtigte man sich gegenseitig und hinterfragte vorgetäuschte Alibis. Neue Beweis- und Hinweisrunden ließen es nicht langweilig werden. Insgesamt war es ein gelungener Abend mit leckerem Essen und neuem, „fairem“ Wissen.
Maureen von Dassel / Andreas Kurschat